Accessibility Tools Barrierefrei mit einem Klick?
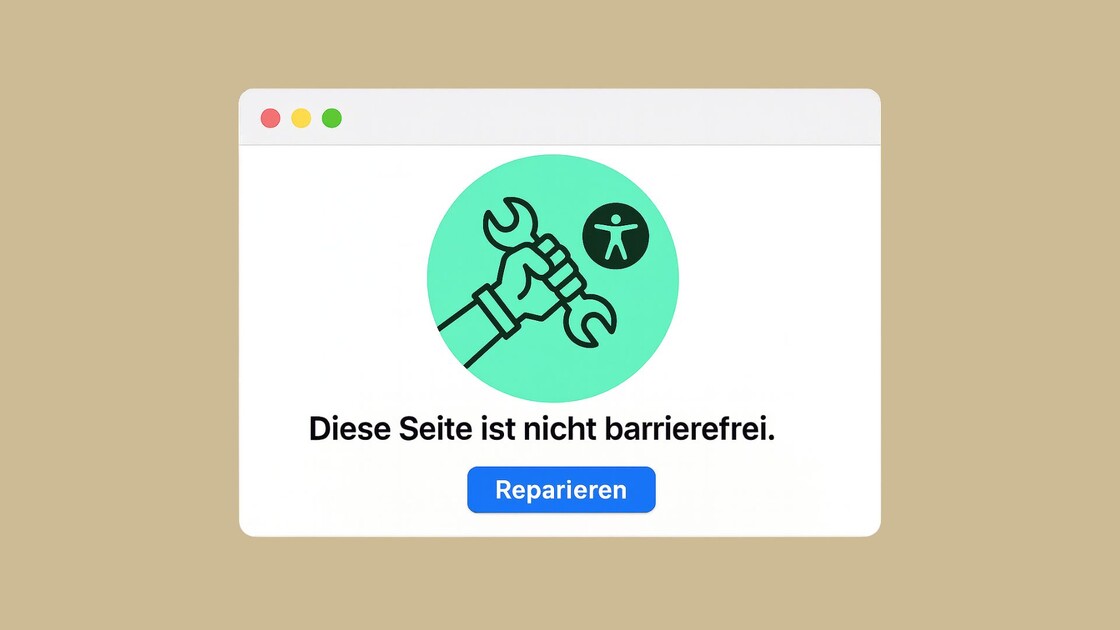
Vor einigen Monaten haben wir uns in einem Blogartikel schon einmal zum Barrierefreiheits-Stärkungsgesetz geäußert, das Anfang Juni 2025 in Kraft getreten ist. Wie so oft bei Compliance-Gesetzesvorhaben treten nun allerorts Akteur*innen auf den Plan, die aus der Unsicherheit, die durch diese Änderung entsteht, Kapital schlagen wollen. Wir möchten in diesem Beitrag auf eine Masche hinweisen, die wir in letzter Zeit an verschiedenen Stellen selbst beobachtet haben.
Ende Mai fand in Berlin die alljährliche re:publica statt, auf der wir in kleiner Delegation als Besucher*innen vertreten waren. Neben zahlreichen Vorträgen, die sich vornehmlich mit Rechtsruck in der Gesellschaft oder dem Themenkreis Künstliche Intelligenz widmeten, interessierte mich persönlich auch ein Vortrag, der die Änderungen durch das Barrierefreiheits-Stärkungsgesetz beleuchten sollte. Wir sind natürlich daran interessiert, wie andere Dienstleistende im NGO-Umfeld das Thema einschätzen. Decken sich unsere Einschätzungen mit denen anderer?
Die Stoßrichtung dieses Vortrags war jedoch eine andere. Zu Beginn wurde das Publikum eindrücklich gewarnt, wer jetzt alles Gefahr läuft, rechtlich für mangelnde Barrierefreiheit belangt zu werden. Anschließend wurde ein recht vager, persönlicher Bezug zum Thema hergestellt ("der Bruder vom Freund einer Bekannten hat eine Gehbehinderung, das hat mir die Augen geöffnet"), um dann als Lösung ein Produkt vorzustellen. Statt Information gab's also einen Marketing-Vortrag. Auch Kolleg*innen, die vor kurzem auf dem TYPO3-Camp in Mitteldeutschland zugegen waren, berichteten von einem Vortrag, der mit ähnlichem Aufbau in die gleiche Kerbe schlug.
Worum geht's genau?
Viele öffentliche Institutionen waren auch vorher schon im Rahmen der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV) zur Barrierefreiheit angehalten. Durch das neue Gesetz sind künftig nun weitere Anbieter*innen verpflichtet, ihre Online-Auftritte zugänglich zu gestalten. Dazu gehören kostenpflichtige Angebote wie Online-Shops; aber auch Spendenfunktionen, kostenpflichtige Materialbestellungen oder Veranstaltungsanmeldungen könnten betroffen sein. Werden die Barrierefreiheits-Anforderungen nicht erfüllt, besteht ein Risiko für Abmahnungen - das ist teuer und schadet der Reputation. So weit, so plausibel.
Was also tun, um sich davor zu schützen? Gibt es nicht eine Möglichkeit, um die eigene Website irgendwie barrierefrei zu bekommen? Und das möglichst kostengünstig?
"Natürlich" antworten findige Unternehmen, die dieses Thema als Geschäftsfeld erkannt haben. "Wir bieten Ihnen ein Barrierefreiheits-Widget an, das Sie mit wenigen Handgriffen auf beliebigen Websites einbinden können".
Die Funktionen dieser Widgets klingen erstmal auch nicht schlecht. Per Klick können Website-Besucher*innen ein Menü öffnen, das zahlreiche Barrierefreiheits-Anpassungen bereitstellt. Es können Schriftgrößen angepasst, Kontraste oder Abstände erhöht oder Animationen deaktiviert werden. Je nach Ausprägung wird sogar damit geworben, dass das Tool die Website auf Probleme scannen kann oder fehlende Alternativtexte durch KI ergänzt werden. Das alles gibt's für einen schmalen Taler im Abo. Dass man natürlich keine Garantie abgeben könne, dass die Seite dadurch barrierefrei wird, ist nur Teil eines Nebensatzes. Aber man ist doch zumindest ein ganzes Stück weiter gekommen, oder?
Was ist daran auszusetzen?
In diesen als Informationsvorträgen getarnten Werbeveranstaltungen fehlt allerdings der Begriff, unter dem solche Tools in entsprechenden Kreisen bekannt sind: "Accessibility Overlays". Dass der Begriff nicht genannt wird, liegt sicherlich nicht daran, dass er die Funktion unzulänglich beschreibt. Vielmehr habe ich den Eindruck, dass dem interessierten Publikum vorenthalten wird, unter welchem Stichwort man sich darüber - unabhängig von einem Anbieter mit finanziellen Interessen - weiter informieren könnte. Die Aussage im oben erwähnten re:publica-Vortrag ("für das, was wir machen, gibt's sonst nur noch einen weiteren Anbieter, der sitzt aber in den USA") stimmt jedenfalls nicht.
Gibt man "Accessibility Overlay" in einer Suchmaschine der Wahl ein, landet man schnell auf Seiten, die sich aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung mit diesen Tools auseinandersetzen. Zu nennen wäre da zum Beispiel der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband, die Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit in der Informationstechnik oder auch die Website zum Overlay Factsheet, dem sich zahlreiche internationale UX- und Accessibility-Profis angeschlossen haben. Allen ist gemein, dass sie kein gutes Haar an dem Konzept lassen. Die Begründungen lassen sich auf drei wesentliche Punkte zusammenfassen:
1. Barrierefreiheit muss von Beginn an in einem Projekt berücksichtigt werden
Die Anforderungen an Barrierefreiheit sind wesentlich komplexer, als es die Overlays darstellen. Es geht nicht nur um ein paar bessere Kontraste oder Abstände. Wer sich den Katalog der Prüfschritte für einen BITV-Test genauer anschaut, wird schnell erkennen, dass solche Widgets bestenfalls eine Handvoll davon berühren.
Um nur einige der anderen Punkte zu nennen: konsistente Navigationsstrukturen, verständliche Formulierungen, semantische HTML-Auszeichnungen, zugängliche Formularbeschriftungen und -fehlermeldungen, Tastaturbedienbarkeit - nichts davon kann ein Widget nachträglich korrigieren.
Schriften, Kontraste und Abstände sind zudem die lowest hanging fruits der Barrierefreiheit. Ein Overlay-Widget vereinfacht also bestenfalls den bereits am wenigsten aufwändigen Teil der Anpassungen. Eine Website, die aber davon abgesehen nicht zugänglich ist, wird es auch nach Einbindung eines Widgets nicht sein.
Das wiederum können wir garantieren.
2. Overlays fügen keine Funktionen hinzu, die nicht bereits anderweitig abgebildet werden
Wer auf hohe Kontraste, bestimmte Farbschemata oder größere Schrift angewiesen ist, kann all diese Einstellungen im eigenen Browser einstellen - und zwar so, dass sie für alle Websites gleichermaßen gelten (nicht nur die, auf denen ein bestimmtes Widget eingebunden ist). BITV-Prüfschritt 11.7 untersucht explizit, dass so von Nutzer*innen vorgegebene Farben und Schriften nicht von der Website wieder überschrieben werden. Auch eine Vorlesefunktion haben Menschen in der Regel bereits installiert - oder nutzen die Sprachausgabe, die viele Betriebssysteme unterdessen mitliefern.
Die Zielgruppe dieser Widgets scheinen also nicht Betroffene zu sein, sondern eher verunsicherte Website-Betreiber*innen, die mit dem Thema Barrierefreiheit sonst wenig Berührung haben.
3. Accessibility-Widgets schaffen neue Barrieren
Grundsätzlich ist keine Website dazu verpflichtet, Zusatzfunktionen für Barrierefreiheit bereitzustellen. Sind solche Funktionen eingebunden, ist es allerdings unabdingbar, dass diese auch selbst zugänglich aufgebaut sind (vgl. Prüfschritt 5.2). Je nach Einbindung kann es also passieren, dass Overlay-Tools neue Probleme auf der Website hervorrufen, statt Barrieren zu beseitigen.
Es ließen sich weitere Punkte anführen, die gegen den Einsatz solcher Tools sprechen. Wir haben beispielsweise noch nichts zum Thema Datenschutz gesagt. Da solche Overlays über Server der jeweiligen Anbieter ausgeliefert werden, können diese mitschneiden, wer welche Seite wie oft aufgerufen hat. Dies betrifft übrigens schon die Einbindung, dazu muss ich als User das Overlay noch nicht mal aktiviert haben.
Fazit
Wir empfehlen also: Finger weg von Accessibility Overlays. Ich nenne das digitalen Ablasshandel: Ganz einfach und für nur ein paar Euro im Monat barrierefrei zu werden klingt nicht nur zu gut, um wahr zu sein, sondern ist es auch. Wir können nur hoffen, dass auch die Zuhörenden solcher Vorträge das feststellen und skeptisch bleiben.
Anstelle vermeintlicher Ein-Klick-Lösungen unterstützen wir unsere Kund*innen darin, tatsächliche Verbesserungen der Zugänglichkeit ihrer Online-Auftritte zu erreichen. Sprechen Sie uns gern darauf an.